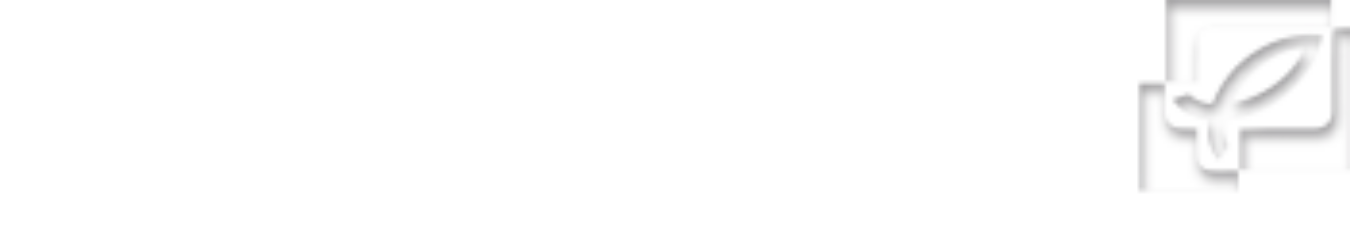Was hat Sie motiviert, in die Klinikseelsorge zu kommen?
Nach 23 Jahren Gemeindepfarramt in Hoyerswerda-Neustadt folgte ich Hanns-Christoph Richter, der in den Ruhestand trat, in die Klinikpfarrstelle im Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda; ich hatte die KSA-Qualifikationen, die für ein solches Spezialpfarramt nötig sind, bereits im 1. Teil absolviert und bildete mich in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Medizin-Ethik, Krisenintervention, Notfallseelsorge u. a., im Laufe der Zeit diesbezüglich weiter.
Ein Kollege hatte mich darauf hingewiesen und auch die damalige katholische Ordensschwester am Klinikum meinte, sie würde sehr gern mit mir zusammen arbeiten.
Veränderung war dran – das gab den Ausschlag. So wechselte ich in die 1. Kreispfarrstelle für fast 4 Jahre, und seit fast 5 Jahren bin ich Klinikpfarrerin am Städtischen Klinikum in Görlitz. Ein unkomplizierter Wechsel von der 1. in die 2. Kreispfarrstelle.
Ich arbeite gern vielfältig und abwechslungsreich; kein Tag ist wie der andere.
Es ist für mich reizvoll, mich als Kirchenfrau in einem gesellschaftlich wichtigen Bereich wie dem Gesundheitswesen aus- und einzusetzen mit meinen Gaben & Möglichkeiten.
Unabhängig, interprofessionell.
Der Anfang war schwer, weil es überraschenderweise viel Ablehnung vom Personal gab, inzwischen bin ich gut integrierte Externe. Ich muss mich längst nirgendwo mehr vorstellen. Es ist ein missionarischer Dienst in Weite & Fülle, auch wenn ich das nicht vor mir hertrage. Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kommunikation für alle Menschen; den Kleinen, den Großen, den Alten, den Jungen. Es reizt mich, dem christlichen Analphabetismus zu begegnen. Spannend, dies in einem Lebensbereich mit manchen vulnerablen und fragilen Erfahrungen zu tun. Auch gerade hier haben wir einen Auftrag als Kirche, der von Jesus kommt.
Welche Rolle spielt der Glaube in der Arbeit mit Patienten und Patientinnen in einer Klinik?
Zunächst möchte ich sagen, dass es vier Aufgabenbereiche für Klinikseelsorgende gibt. Das wissen auch Gemeindeglieder meist nicht.
- Besuch bei Patientinnen & Patienten
- Gespräche mit Angehörigen
- Seelsorge für das Personal (rund 1450 im SKG)
- Unterricht in der Generalistischen Pflege-Ausbildung & Fortbildung für Personal und die Mitwirkung im Klinik-Ethikkomitee, dessen stellvertretende Vorsitzende ich bin. Ich komme als Christin & Pfarrerin; als hoffende Gläubige. Als solche bin ich in persona Teil der Kirche Jesu Christi und begleite Menschen, unabhängig von ihrer Religion &Weltanschauung in der verordneten Auszeit in Situationen von Krankheit, Schmerzen, Leid, Not, aber auch am Lebensanfang, in Kindheit, Jugend, es geht um „Begleitung, Begegnung und Lebensdeutung im Horizont des Glaubens“, ganz gleich, ob sie christlich sind oder nicht – besser als Michael Klessmann kann ich das nicht sagen. In der konkreten Situation eines Menschen geht es um Kraftquellen, Hoffnung, Zuversicht und Mut. Das Mit-Aushalten und Durchhalten ist eine echte Arbeit. Lachen und Weinen, wertschätzendes Wahrnehmen, Klagen & Danken – so vieles birgt der Auftrag Jesu in seinem „Was brauchst du jetzt von mir?“ Dabei begegne ich den unterschiedlichsten Menschen in ihrer Sprache. Den Juden wie eine Jüdin, den Griechen wie eine Griechin sozusagen. Das bleibt herausfordernd; das Evangelium niedrigschwellig in den Kontext der Menschen zu übersetzen. Die meisten Menschen – machen wir uns nichts vor – haben keinen Bezug zur Kirche. Doch jeder Mensch trägt eine spirituelle Dimension in sich; daran kann ich anknüpfen. Oft geht es auch um einen Perspektivwechsel, um Aufmerksamkeitsarbeit, darum, gemeinsam zu entdecken, was vielleicht verborgen, dennoch da ist. Und so manches Mal geht es thematisch gar nicht um die konkrete Krankheit im Patientengespräch. Alles, was das Leben birgt, darf ins Seelsorgegespräch gebracht werden. Wir erreichen die Menschen, wenn es ihre Lebenswirklichkeit betrifft. Ich versuche, Gottes Geist darin nicht im Wege zu stehen.
Wie gehen Sie mit der emotionalen Belastung um, die mit der Begleitung von kranken und sterbenden Menschen verbunden ist?
In der Begleitung von Kranken und Sterbenden geschieht nicht nur Erdenschweres und tief Trauriges. Sterbende zu begleiten, ist ein berührender Dienst, aber nicht das Schwerste für mich in der Seelsorge. Natürlich ist Begleitung immer sehr individuell.
Oft spüre ich Gottes zärtliche Berührung gerade dann und darf auch als Beschenkte weitergehen. Klingt komisch, ist aber so. Kraftzehrend sind Sterbe-Begleitungen von jungen Menschen und ihren Angehörigen. Dann bin ich auch intensiv mit dem Personal im Gespräch, die in aller Professionalität auch Menschen sind. Belastend finde ich es, wenn alte Menschen sich nicht mit der Endlichkeit ihres Lebens auseinandersetzen möchten und so tun, als ob sie ewig hier leben würden und die Medizin es schon richten müsse. Der Umgang mit Grenzen und Endlichkeit wird sehr oft tabuisiert. Gutes Leben ist im Blick. Was aber ist Gutes Sterben? Medizin und Ethik, Medizin und Ökonomie sind große Themen, bei denen wir etwas einbringen können und müssen.
Hier gibt es Erwartungen. Herausfordernd für mich ist z. B. religiöser Wahn bei psychisch erkrankten Patienten. In der Klinikseelsorge gibt es die Pflicht zur Supervision, die unsere Kirche bezahlt. Wir haben in unserer Landeskirche, so auch im Kirchenkreis, Klinikseelsorge-Konvente, in denen wir fachlich arbeiten, aber auch kollegiale Beratung möglich ist. Das trägt.
Und wir lernen selbstverständlich, in diesem ganzheitlich herausfordernden Dienst für uns selbst zu sorgen; „Self Care in helfenden Berufen“ biete ich in Fortbildungen in der Klinik für das Personal an, es gilt genauso für mich. Persönliche Psychohygiene ist nötig.
Ich brauche z. B. einen Tag, an dem ich mich zurückziehe und keine Gespräche führe.
Welche Erfahrungen oder Begegnungen aus Ihrer Arbeit in der Klinikseelsorge sind Ihnen bisher besonders in Erinnerung geblieben?
Da gibt es nicht wenige. Etwa die Nottaufe auf der Neonatologie-Station; gemeinsam mit Chefärztin, Pflegekräften, der katholischen Familie, den Geschwisterkindern, die anschließend noch begleitet wurden. Oder die Trauung eines Patienten, der es bis zum anstehenden Hochzeitstermin nicht mehr geschafft hätte. Die Frau brachte ihr Brautkleid, die Schuhe mit in die Klinik-Kapelle, es war ein sehr bewegender Moment. Ich denke an manches Gespräch mit Männern auf der Urologie-Station nach einer Prostatakarzinom-Operation. In diesem sensiblen Bereich entstehen oft intensive Gespräche über Partnerschaft, Sexualität. Hier fließen auch paartherapeutische Ansätze ein. Ich staune manchmal über die Offenheit, wenn der Vertrauensraum eröffnet ist. Das Schönste waren bisher die Entbindungen, die ich mitgemacht habe, das große Vertrauen der Hebammen dabei oder die OP-Begleitungen, aber das wäre schon ein eigenes Thema. Eine bewegende Begleitung war für mich die meines Pfarrkollegen Martin Zinkernagel in Corona-Zeit auf der Intensivstation. Ich segnete ihn, bevor er seinen letzten Weg antrat. Als seine Frau weg war, blieb ich noch da. Da flossen Tränen, die aber wohl keiner sah im weißen Schutzanzug. Ich nenne ihn jetzt einfach mal namentlich, weil er somit in unseren Gedanken bleibt und nicht vergessen ist. Oder die Mehrfach-Reanimation eines Säuglings. Ein Umstand, der Gott sei Dank sehr selten vorkommt. In dieser Nacht haben wir – Chefärztin, Ärztinnen & Ärzte, Intensivpflege und dann eingeflogene Spezialistinnen aus Dresden alles Menschenmögliche getan, um das Baby zu retten. Da die Eltern bereits schon einmal ein Kind verloren hatten, war ich mit ihnen die ganze Zeit dabei. In solchen Situationen bin ich erst für die Angehörigen, anschließend für das Personal da. Es gab dann eine retrospektive Fallbesprechung, auf die ich mich sehr intensiv vorbereitete. Wertschätzung wirkt manchmal Wunder. Vielleicht nehmen wir in den Gemeinden 2025 mal bewusst auch Ärzteschaft & Pflegepersonal in den Blick und fragen ehrlich interessiert, wie es ihnen geht.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Klinikseelsorge?
Ich wünsche uns als Kirche, dass wir die Seelsorge neben Lehre und Predigt als Kernkompetenz in vielfältigen Bereichen des Lebens lebendig füllen. Dass wir selbstbewusst hineinwirken in die Millieus, und dass wir uns von anderen Anbietern nicht verdrängen lassen. Dabei braucht es Menschen, die aktiv auf andere zugehen, wertschätzend kommunizieren, zuhören und zum Evangelium einladen. Schüchtern sein, hilft nicht weiter. Warten, dass jemand kommt, ist eine überholte Haltung. In der EKBO arbeiten derzeit 98 Seelsorgende in knapp 90 Kliniken. Unsere Landeskirche ist mit den Klinikleitungen im Gespräch, um verstärkt Refinanzierungen zu erwirken. Ich wünsche uns, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern unsere Seelsorge-Kompetenzen, samt Qualifikationen klar und deutlich machen, damit auch Geschäfts-Leitungen wissen, was sie an uns haben. Und uns gern unterstützen. In Zukunft werden wir vermehrt auf Refinanzierungen angewiesen sein. Wie kann also Klinikseelsorge als Teil der Gesundheitsfürsorge im Gesundheitssystem noch stärker implementiert werden? Ist Klinikseelsorge nicht auch eine Art Heil-Beruf? Was kann das bedeuten? 2023 hatten wir eine Bischofsvisitation für den gesamten Bereich der Klinik- und Altenheimseelsorge in unserer Landeskirche. Ich finde es wichtig, dass binnenkirchlich Dienste gesehen werden, die oft im Verborgenen geschehen. Die Visitation brachte den weiterführenden Auftrag, eine Landeskirchen-Konzeption zu erstellen für diese Kernaufgabe der Kirche. In dieser Kommission arbeite ich im Konsistorium intensiv mit. Im September müssen wir ein Konzept vorstellen. Ich wünsche mir, dass diese Mammutaufgabe gelingt. Ich finde es falsch, wenn wir uns nur auf alte und sterbende Menschen seelsorgerlich begrenzen. Die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien brauchen auch Seelsorge in vielfältigen Formen. Ich wünsche, dass dieser Blick weiter geschärft wird. Und dass Klinikseelsorge in der Gesundheitsreform als weiterhin unabdingbar und nötig gesehen wird. Dafür müssen und können wir aber alle etwas beitragen.
Interview und Fotos: Małgorzata Pyzik
Herzliche Einladung: Samstag, den 17. Mai von 10:00 bis 15:00 Uhr zum Erlebnistag im Städtischen Klinikum Görlitz anlässlich des 120-jährigen Jubiläums des Klinikums.
Besuchen Sie den Stand der Klinikseelsorge am Bistro, in der Nähe des Haupteingangs.