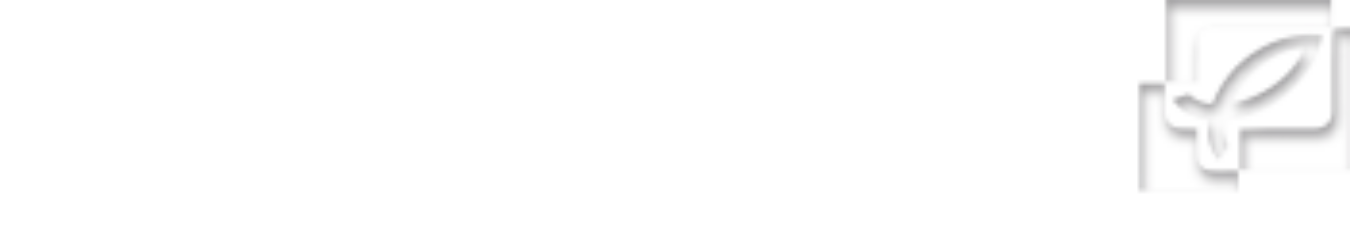Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni haben wir ein Gespräch mit Schwester Katarina Seifert geführt.
Sie engagiert sich im Bereich „Flucht und Willkommen“ beim CVJM SOL und berichtet aus ihrer täglichen Arbeit mit geflüchteten Menschen.
Was hat Sie dazu bewegt, mit geflüchteten Menschen zu arbeiten?
Dafür gibt es eigentlich keinen speziellen Grund. Ich bin Diakonisse geworden, um anderen Menschen zu helfen. Die Geflüchteten waren da und brauchten Unterstützung. Die kann jeder auf einfache Art und Weise geben. Also habe ich es getan. Zur Silvesterfreizeit 2016/17 wurde ich dann von Thomas Brendel nach einer Zusammenarbeit mit dem CVJM gefragt. Es passte in meine berufliche Situation. Der Umgang mit Menschen aus anderen Ländern, mit anderen Sprachen, macht mir schon immer viel Freude.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus, und was sind typische Herausforderungen?
Besuche von geflüchteten Menschen und Kontakte zu Sozialarbeitern gehören genauso zu meinen Aufgaben wie Netzwerktreffen und Vorträge in Gemeinden. Regelmäßig montags bin ich im „Café International“ in Niesky zu finden.
Am 21. September soll die Eröffnung der Interkulturellen Woche für den Landkreis Görlitz in Niesky stattfinden. Ich bin gerade mit der Vorbereitung dieser Veranstaltung und unseres jährlichen Begegnungsfestes „Niesky interkulturell“ beschäftigt. Herzliche Einladung an dieser Stelle!
Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist es, den Flüchtlingen ihre Möglichkeiten hier in Deutschland aufzuzeigen. Für diese Beratung muss man immer am Puls der Zeit bleiben und aktuelle Informationen kennen.
Eine besondere Herausforderung ist für mich die ablehnende Haltung vieler Menschen gegenüber Geflüchteten. Besonders schwer ist das, wenn diese in großer Angst vor Misshandlungen in anderen europäischen Staaten in unseren Gemeinden um Kirchenasyl bitten. Hier ist es schwer, diese Angst auszuhalten und nur schleppend oder gar nicht helfen zu können.
Gab es eine Begegnung, die Sie besonders berührt oder geprägt hat?
Die Erlebnisse geflüchteter Menschen, aber auch die verschiedenen Kulturen sind sehr eindrücklich. Bei den Begegnungen und Gesprächen gibt es deshalb immer wieder Schlüsselerlebnisse für mich. In den Jahren seit 2016 habe ich in meinen Rundmails viele Menschen daran teilhaben lassen.
Ein junger Mann erzählte mir, wie er in Bulgarien am Boden liegend mit Eisenstangen geschlagen wurde. Er war einer der ersten, der mir persönlich und detailliert von den Verhältnissen für Geflüchtete, von den Zuständen in den Gefängnissen und den Misshandlungen dort berichtete.
Wie erleben Sie die Stimmung in der Gesellschaft gegenüber Geflüchteten?
Mir gegenüber äußert sich selten jemand kritisch über Migranten. Die Berichte der Zugewanderten machen aber eine deutlich zunehmende Ablehnung sichtbar, die sich in Alltagserfahrungen widerspiegelt. Für geflüchtete Menschen ist das sehr deprimierend. Viele gehen deshalb in andere Bundesländer.
Eine kleine Freundlichkeit oder Hilfe durch Einheimische wird von unseren neuen Freunden dagegen sehr dankbar wahrgenommen und reflektiert.
Was bedeutet für Sie persönlich eine echte Willkommenskultur?
Es gibt viele Berichte von einer Willkommenskultur, die Deutsche auf Reisen in anderen Ländern erlebt haben. Warum können wir das nicht?
Kürzlich erzählte mir ein älterer Herr, er habe vom Bahnhof im nächsten Ort einen Ausländer im Auto mitgenommen. Der habe beim Aussteigen in gutem Deutsch gesagt: „Sie sind der Erste hier in Deutschland, der mich in sein Auto gelassen hat.“ Eine Willkommenskultur zeigt sich in den kleinen Alltagsdingen.
Neben dieser persönlichen Willkommenskultur brauchen wir auch positive politische Signale.
Wenn Sie an die Zukunft denken: Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit?
Ich wünsche mir viele Ehrenamtliche, die mit Freude das Gespräch mit Geflüchteten suchen und sie in den kleinen Dingen des Alltags beraten und unterstützen. Ich wünsche mir Menschen, die den Ankommenden ihre Freundschaft anbieten. Das wäre mir eine Herzensfreude.
Und ich wünsche mir eine politische Wende …