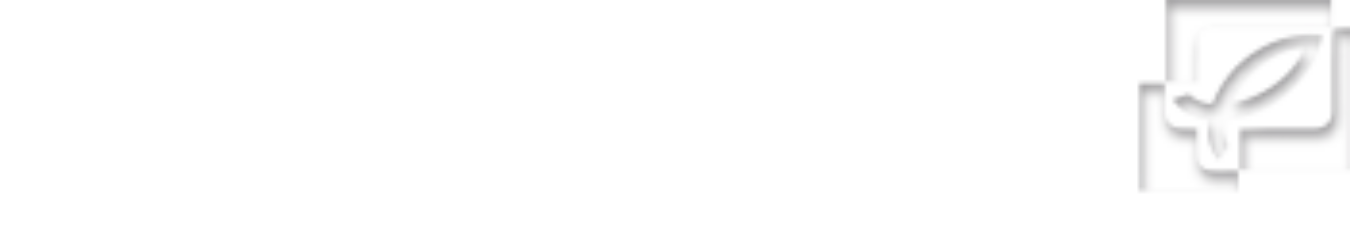Für die heutige Akademie-Mitteilung habe ich für Sie drei Themen, drei Perspektiven ausgewählt, die, wie immer tiefere Bestände aufgreifen und dadurch auch etwas unser aktuelles Geschehen und unsere gesellschaftliche Lage erhellen sollen aber auch eine europäische Dimension besitzen:
Zunächst möchte ich, einem großen inneren Bedürfnis folgend, einen Nachruf auf den österreichischen, ja, was schreibt man jetzt alles – Schriftsteller, Übersetzer, Journalist, Slawisten… Martin Pollack schreiben. Schon am 17. Januar ist er 80-jährig in Wien verstorben. Er hinterlässt ein großes Gesamtwerk, das in 15 Sprachen übersetzt, eine weite Verbreitung fand.
Er gehörte damit zu den, leider immer noch recht wenigen allseitig-europäisch Gebildeten, aktiv-geistigen Akteuren, die besonders durch ihre, über lange Jahre erworbene, über parteiischen Autorität beim Ausdeuten unserer tatsächlich komplexen Gegenwarten auch eine gewisse Wirkmächtigkeit erzielten. Er gehörte sowohl mit zu den ersten, als auch zu den bedeutendsten Kennern der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts – von ihren gemeinsamen Verstrickungen bis hin zu den jeweiligen mit Vernichtungsabsicht vorgetragenen unfassbaren Zerstörungswerken, die ihresgleichen auf unserem Erdenrund suchen und deren Auswirkungen bis in unsere Zeit. Was den Nationalsozialismus anging, so hat er ihn wie kaum ein Zweiter und auch kaum eindrücklicher anhand seiner Familiengeschichte beschrieben (siehe Literaturliste Anhang!). Sein lebenslanges Hauptaugenmerk galt dem ostmitteleuropäischen Großraum und dessen Grenzregionen zu Osteuropa und speziell seine Arbeiten zur historischen Teilregion Galizien und Lodomerien, einer der, oft über lange Zeiten multiethnischen, multikonfessionellen bzw. multireligiösen geprägten Kulturlandschaften. . Er hat diese im 20.Jahrhundert weitgehend vernichteten Regionen für uns nicht nur einfach nachvermessen, sondern er hat mit einer Erinnerungsarbeit, die auf Vergegenwärtigung aus war, die weißen Flecke auf der europäischen Landkarte maßgeblich mit getilgt. Genau diese Regionen sind seit 2014 durch eines dieser Imperien, die immer wieder die ostmitteleuropäischen Regionen heimgesucht haben, präzise das Russische Imperium, wieder in ihrer Existenz gefährdet, besonders die Ukraine. Leider ist Ostmitteleuropa – von Martin Pollack auch Zwischeneuropa genannt – nicht einmal seitdem als bedeutsame europäische Großregion erkannt worden, deren Geschichte und Gegenwart engstens auch mit der Zukunft ganz Europas zusammenhängt. Im Gegenteil, besonders Deutschland verfiel gerade ab da an sogar noch verstärkt auf die alten Fehler einer deutschen Russlandpolitik, über die Länder Ostmitteleuropas hinweg. Schlimm, weil wider besseren Wissens, das besonders aus der eigenen unrühmlichen deutsch-russisch/sowjetischen Beziehungsgeschichte heraus hätte gewonnen werden müssen. Besonders weil diese Politik, beginnend im 20.Jahrhundert ab 1917, als Politik, äußerst extrem, nur unterbrochen von 1941-1945 durch einen auf Vernichtung angelegten Krieg , leider über lange Strecken immer vorhanden bis maßgeblich war.
Um sich diesen Raum zu vergegenwärtigen finden Sie im Anhang eine Karte, die der polnisch-österreichisch amerikanische Historiker, Oskar Halecki im Zusammenhang mit dem Ergebnis des Hitler-Stalin-Paktes verwendet hat(Oskar Halecki: Grenzraum des Abendlandes. Eine Geschichte Ostmitteleuropas.Müller, Salzburg 1956).
Jetzt erleben wir gerade am Dritten Jahrestag den Russischen Großkrieges gegen die Ukraine, wie die größte neoimperiale europäische Kriegskathastrophe nach 1945 gegen ein Nachbarland, sich gegen das angegriffene Land, die Ukraine in ein Vernichtungsszenario desselben zu entwickeln beginnt, mindestens aber in einen Zustand, in dem zu befürchten ist, daß eine Mehrheit der Ukrainer Freiheit nicht mehr real erleben werden. Das Ganze könnte dann zynisch noch offiziell als Friedensschluß gefeiert werden. Eine solche Folge kennen fast alle ostmitteleuropäische Länder aus einer Nachkriegsordnung, die aus Zugeständnissen an die selbe imperial veranlagte Siegermacht des Zweiten Weltkrieges, damals Sowjetunion genannt, in Jalta beschlossen worden war. Nun wird der größte Teil dieser, sich 1989/90/91 vom imperialen Joch befreit habenden Länder wieder in diese unmittelbare, freiheitsbedrohende Lage zurückgestoßen werden.
Wenn wir als Deutsche nicht spätestens jetzt sehr schnell verstehen, daß wir Ostmitteleuropa, wenn es schlecht mit Rußland läuft, nicht einfach nur als Puffer betrachten dürfen, sondern daß es um unsere gemeinsame Freiheit geht, dann wird der größtmögliche Fehler passieren können, einer der Europa, so wie wir es kennen, zerstören wird, mitsamt der Freiheit, die immer die größte Differenz zum Frieden in einer Diktatur ausgemacht hat. Das „wir“ jetzt noch wenigstens einen Weg, einen europäischen Weg finden werden, der der Ukraine eine Statur beläßt, wenigstens einigermaßen auf Augenhöhe und in Würde ihren Weg zu gehen,wäre das Mindeste, aber wohl auch noch nicht ausgemacht. Die Schande ist schon jetzt so unglaublich, daß mir einfach momentan die Worte fehlen, nur einigermaßen angemessen zu formulieren. Ich habe so etwas wohl noch nie erlebt.
Das kann jetzt jemand leicht als Spekulation in eine an sich ungewisse Zukunft hinein schelten. Ich betrachte es als eine der wahrscheinlichen Lehren, die man aus der zuordenbaren Geschichte lernen kann und muß. Wenn es besser kommt, dann wird es immer noch nicht gut sein, zumindest nicht für die geschundenen und immer noch tapferen Ukrainer und auch nicht für Ihre unmittelbaren Nachbarn im Westen. Ganz sicher auch nicht für die Ungarn oder Slowaken, auch wenn ihre Regierungen das jetzt noch anders sehen. Solche Geschichten gab es leider auch schon. Ich hab jedenfalls auch von Martin Pollack vieles lernen dürfen, was mich hier eher bestärkt. Gerade wegen unseres derzeitigen großen Bedarfes an solchen Analysten hinterlässt er eine schwer verkraftbare Leerstelle!!!
Martin Pollack war nicht nur ab und an, sondern immer auch ein bedeutender Übersetzter vieler Autoren dieses Raumes, besonders polnischer, die wiederum ihrerseits bedeutsame Beitrage geleistet haben, um uns diese Regionen und ihre Menschen näherzubringen. So zum Beispiel den polnischen Schriftsteller und Essayisten Ryszard Kapuściński, von dem wir unvergleichlich erfahren haben, was eigentlich Weltwissen ist, um nur einen zu nennen.
Sie finden im Anhang nicht nur die Nachrufe verschiedener österreichischer, schweizer und deutscher Zeitungen, sondern auch den Text der Dankesrede, die Martin Pollack anlässlich der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2011 gehalten hat. So haben wir in die Literaturliste auch den Band aufgenommen, der die Vergabe des ersten Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 1994 an Ryszard Kapuściński dokumentiert, wo Martin Pollack als Übersetzer der Dankesrede des Preisträgers beteiligt war. Martin Pollack gerade jetzt zu lesen wäre mir ein Anliegen der Stunde!!!
Als zweites Thema habe ich einen bemerkenswet kenntnisreichen Aufsatz über den immer weiter fortschreitenden Niedergang der Geisteswissenschaften in Deutschland, geschrieben von Michael Hüther, Direktor des rennomierten Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, erschienen jüngst in der FAZ am 19 .Februar, bei gleichzeitiger immer stärker bemerkbarer permanenter Überhebung der sogenannten empirischen Wissenschaften, was nicht nur Ihre Sinnhaftigkeit angeht, sondern auch ihre gesamte Ausrichtung. Sie wirkt zunehmend selbstreferenziell und gibt eine Lösungskompetenz unserer Probleme vor, die in der Realität kaum noch als solche wahrgenommen werden kann. Moderne Wissenschaften im Dienste, insbesondere der digitalen Revolution, sind bei weitem nicht selbsterklärend. Es wäre ein fataler Fehler unser ganzes Potenzial in letztendlich nur Zeitkaufmodelle zu investieren und nicht parallel alles zu tun um diese revolutionären Prozesse auch transparent, verstehbar und nachvollziehbar für die Bevölkerung zu machen. Wir erleben es seit geraumer Zeit, daß die Bildungseinrichtungen in der Vermittlung dieser tiefgreifenden Prozesse zunehmend aussteigen und versagen. Die tatsächlich erfolgten Investitionen in Hardware sind hier nur ein Seite. Die andere Seite wäre die Vermittlung von Vertrautheit mit diesen Prozessen, dem Verständnis der Komplexität und Schaffung für ein Bewußtsein, sowohl für die Chancen wie für die Risiken gleichermaßen. Es sollte um die Herausbildung eines aufgeklärten Korrektivs aus der Gesellschaft heraus gehen. Die geistige Erbärmlichkeit amerikanischer Tec Milliardäre, die sich gerade als zentrale Figuren des Weltgeschehens darstellen, sollte uns in diese Richtung aufrütteln, alles über deren Kernkompetenzen hinaus in die Öffentlichkeit zu tragen.
Das Michael Hüther diesen Einspruch wagt und die dringende notwendige Rolle der Geisteswissenschaften in seinem Text so beschreibt und anmahnt macht Hoffnung. Gerade jetzt, wo die ganze Welt darüber in Kenntnis gesetzt wird, ob es sich bei den selbsternannten Weltenrettern um amerikanische Revolutionäre handelt, die das revolutinär Neue nur auf der Asche des aus ihrer Sicht notwendigerweise zu Vergehenden errichten können oder eben nicht. Die in der Sowjetunion ausgebildeten derzeitigen Revolutionäre jedenfalls sehen es noch immer als besonders gelungen an, wenn sie sich annnähernd rückbindungsfrei entfalten bzw. Rückbindung nur aus taktischen Gründen vortäuschen. Vernichtung ist für sie weiterhin Zweck und Ziel zugleich.
Dazu Hüther allgemein zum Thema: „Nachhaltigkeit entsteht nicht durch das Umettiketieren bestehender Studienangebote, sondern dadurch, dass die naturwissenschaftlichen naturwissenschaftlichen tatsachenfeststellungen geisteswissenschaftlich-historisch, kulturell, semantisch-reflektiert, eingeordnet ,dimensioniert, kompensiert und bewertbar werden. Das müsste eigentlich den Sorgender jüngeren Generation um den Klimawandel entgegenkommen. Das führt uns zu den narrativen Angeboten, die Odo Marquart den Geisteswissenschaften seinerzeit zuwies. Sensibilisierungsgeschichten können in einer Zeit, in der Wandel und Veränderung dominieren, über die Mobilisierung des ästhetischen Sinns einen lebenswichtigen Ausgleich schaffen. Bewahrungsgeschichten sichern Vertrautheit in der Lebenswelt, die scheinbar dem Motto unterworfen ist, daß alles geändert werden kann.
Eines wird man akzeptieren müssen, wenn man sich auf die Geisteswissenschaften einläßt: der weithin etablierte Gewissheitsüberschuß wissenschaftlicher Positionen und darauf beruhender Kommunikation wird nicht weit tragen.wir stehen zwar nicht, wie manche populistische Kritik an geisteswissenschaftlicher Theoriearbeit suggeriert, vor einer inszenierten Kulisse der Beliebigkeit, aber eben in einer Welt der Vieldeutigkeit. Die Komplexität, die sich aus der Vernetzung der Sachzusammenhänge ergibt, trifft auf die Gleichzeitigkeit der Veränderungsbewegungen. Darin Fäden zu finden, die sich zusammenbinden lassen, wird nur gelingen, wenn man der Vieldeutigkeit Raum gibt, aber im Sinne der narrativen Angebote der Geisteswissenschaften versucht, Muster und bedingungen zu identifizieren, Rollen und Verantwortung zu benennen.“ Es lohnt sich besonders den ganzen Text zu lesen, siehe Anhang FAZ 19. Februar 2025
Das dritte Thema ist mehr oder weniger, eher weniger, ein Thema in eigener Sache. Nach langer Zeit wird es wohl gelingen, die Internetedition des politischen Zeitschriften-Samizdats der DDR – oder anders ausgedrückt – die digitale Edition der etwa 120 Zeitschriften wieder sichtbar zu machen, die besonders ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre im Untergrund entstanden sind. Dies ist insofern erwähnenswert – auch im Zusammenhang mit Martin Pollacks Wirken – weil dieser Samizdat, ab der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, in vielen Ländern des Sowjetischen Imperiums entstanden, ein bedeutsames Element des Widerstandes gegen die kommunistischen Diktatoren und ihrer weitgehenden Praxis, gewaltsam ihre Vorstellungen von Zensur durchzusetzten,war. Zu verstehen auch als eine der bedeutendsten Ausdrucksformen für den Freiheitswillen in all den Ländern, die unter dem Verlust der Freiheit litten.
Dazu fand am 31. Januar 2025 eine wunderbare Veranstaltung am Ort unseres damaligen und jetzigen Projektpartners an der TU Dresden und SLUB Dresden statt. Diese Veranstaltung wies auf die Wiedersichtbarmachung der digitalen Edition des politischen Zeitschriften-Samizdats in der DDR hin. Verbunden war diese Veranstaltung mit einem internationalen Netzwerktreffen, an dem Partner aus Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik sowie der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen teilnahmen. Es war ein großer Mutmacher nicht nur für uns, weil der Samizdat ein großes Thema ist – nicht nur während der Diktatur, sondern weil er auch einen starken Einfluss auf die Überwindung der Diktaturen hatte, um Freiheit wieder erlebbar zu machen.
Um nun wieder einen Bogen zu unserem Thema, das Martin Pollack gesetzt hat zu schaffen, finden Sie im Anhang den Text einer Rede, die ich 2005 anlässlich einer Konferenz zur Veröffentlichung dieser Samizdat-Edition in Berlin im Roten Rathaus beigetragen habe, in der es auch um die diebezügliche ostmitteleuropäische Dimension und ihre Bedeutung für ein zusammenwachsendes Europa geht. Auch hier kann man leicht sehen, daß wir nicht wenig vom Weg abgekommen sind aber eben auch wie man wieder auf den Weg kommen kann. Text aus: „Samisdat in Mitteleuropa. Prozeß – Archiv – Erinnerung“ Thelem Verlag Dresden, 2007
So, das wars für heute. Ich hoffe, wie immer, auf ihr Interesse zu stoßen.
Haben Sie eine anregende Zeit mit der Lektüre und bleiben Sie mir und uns mit der Akademie-Herrnhut gewogen!